Die Bundesregierung ist in einer Kriegszeit gewählt worden und die Zeiten sind wirtschaftlich herausfordernd für Europa. Im Augenblick sprechen Experten eher über die Anschaffung von Waffen als darüber, wie die Menschheit als Ganze weiterkommen kann. Die Entwicklung läuft einer der großen Errungenschaften von Kulturnationen entgegen: Sie sind aus der Selbstbetrachtung und dem Egoismus herausgekommen und haben ein Verantwortungsbewusstsein für den Süd-Nord-Dialog gewonnen. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie die besondere Qualität der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wieder nach vorne bringt.
Beobachten Sie einen Rückzug auf nationale Interessen in der Gesellschaft?
Ja, und eine Fokussierung auf wirtschaftliche Interessen. So wichtig die sind, wir haben größere humanitäre Fragen vor uns: Wie kann wirklich Friede gelingen und wie können Menschen versorgt werden, die seit Jahren oder seit Generationen Flüchtlinge sind, die meisten als Binnenvertriebene im eigenen Land oder als Flüchtlinge in ihrer Region?
Spürt Misereor selbst Gegenwind von Populisten, die unter anderem das Thema Migration nutzen?
Ich erlebe erfreulicherweise, wie sehr Misereor für seine wirksame Arbeit geschätzt wird und auch dafür, dass es Missstände mutig benennt. Misereor hat in seiner Geschichte provokante Dinge eingeleitet, die erst Jahre später zu Bewusstseinsänderungen geführt haben. Das ist eine unserer Spezialitäten. Deshalb müssen wir nicht von allen gelobt werden.
Stehen Erfolge der langjährigen Anwaltschaft wieder in Frage, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz?
Wir müssen in der Tat nüchtern anerkennen, dass vieles, was als gesichert gilt, schnell wieder beschädigt werden kann. Mit dem deutschen Lieferkettengesetz wurden Unternehmen erstmals verpflichtet, Menschenrechte in ihren Lieferketten auch im Ausland zu achten. Die EU-Lieferkettenrichtlinie führt eine EU-weite zivilrechtliche Haftungsregel ein, wenn Unternehmen Schäden verursachen. Das sind zentrale Errungenschaften auf dem Weg zu einer gerechten und nachhaltigen Wirtschaft. Die Arbeitsbedingungen beim Schürfen von Rohstoffen, in der Textilindustrie oder bei Teepflückerinnen sind unerträglich. Kinderarbeit können wir nicht lächelnd hinnehmen oder großzügig übersehen. Wir sind alle mitverantwortlich, wenn Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, leiden, sterben.
Tritt Misereor auch für eine erneute Entschuldung armer Länder ein?
Ja. Bei meinem jüngsten Besuch in Kenia musste ich erneut mit ansehen, wie die immer drückendere internationale Schuldenlast vor allem die Ärmsten belastet. Da sehen wir uns mit unseren Partnern berufen, ihnen international eine Stimme zu geben. Gemeinsam mit einem großen internationalen Bündnis setzen wir uns gerade dieses Jahr, im Heiligen Jahr, dafür ein, dass hochverschuldeten armen Ländern die Schulden erlassen werden, damit sie ihre staatlichen Einnahmen endlich für nachhaltige Entwicklung nutzen können. Wir möchten auch, dass das Wohlergehen von Menschen Priorität vor den Interessen von Finanziers bekommt und unter dem Dach der Vereinten Nationen eine rechtsverbindliche Schuldenrahmenkonvention vereinbart wird. Klar, das wird ein langer Weg, aber wir halten daran fest, dass einseitig genutzte Chancen eines internationalen Kapitalsystems nicht auf Dauer ganze Volkswirtschaften und die Ärmsten der Armen belasten dürfen.
Welche anderen Themen der Anwaltschaft sind jetzt vordringlich?
Aktuell wehren wir uns gemeinsam mit südamerikanischen Partnern gegen die Ratifizierung des EU-Mercosur-Handelsabkommens, das Brandrodungen für Zucker- und Sojaanbau, Viehzucht im Amazonas sowie Vertreibungen von Indigenen verschärfen könnte. Und gemeinsam mit Partnern fordern wir, die nationalen Klimaschutzpläne an den Notwendigkeiten der Klimakrise auszurichten. Wir sehen auch hier, dass arme Länder oftmals keine Möglichkeiten haben, die für sie nötigen Maßnahmen zur Emissionsminderung, Anpassung oder den Schutz vor klimabedingten Schäden auf den Weg zu bringen. Hierfür fordern wir gemeinsam mit unseren Bündnissen, dass reichere Länder ausreichend Klimafinanzierung bereitstellen. Fachleute schätzen, dass bis 2035 mindestens 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr an Finanzierung aus öffentlichen und privaten Quellen für die Entwicklungsländer notwendig sind.
Wie beurteilen Sie die Haltung des Entwicklungsministeriums angesichts der Sparzwänge?
Ich sehe, dass die Bundesregierung sich neu aufstellt. Wir müssen uns aber ins Gedächtnis rufen, dass ein Großteil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus ethischen Motiven geplant worden ist und nicht zu unserem wirtschaftlichen Vorteil. Man kann neue, kreative Bündnisse schließen. Eine Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Technologieentwicklung kann, wenn sie von den Maßstäben geleitet wird, für die wir stehen, zum Beispiel in Afrika viel Gutes bewirken. Dort gibt es Reichtümer, die mit technischem Knowhow und einer fairen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mehr genutzt werden können. Aber aus der Tradition der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gehen wir daran anders heran als hemmungslose Kaufleute von seltenen Erden oder die, die mit einseitigen Abkommen in jedem Fall Gewinn für ihre Nation machen wollen.
Sie beziehen sich darauf, dass das BMZ noch stärker deutsche Firmen einbeziehen will. Zusammenarbeit der Entwicklungspolitik mit Unternehmen finden Sie richtig, aber nur, solange sie von ethischen Zielen geleitet ist?
Ja. Das ist eine Errungenschaft, für die wir in Deutschland besonders stehen. Wir haben stets mehr eigene Interessen, als uns bewusst sind. Doch es zum Programm der Entwicklungszusammenarbeit zu machen, dass wir endlich auch mal vorrangig auf unsere Interessen achten müssen, scheint mir eine neue und kulturell rückschrittliche Tonlage.
Der Etat des BMZ ist deutlich gekürzt worden. Spart es jetzt an den richtigen Stellen?
Nicht unbedingt. Deutschland ist langfristig gut aufgestellt, wenn es die Pluralität der Ansätze in der Projektarbeit fördert. Die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit kann mit hoher Spendenbereitschaft und großem Knowhow Netzwerke vor Ort und damit Wirksamkeit und Nachhaltigkeit bringen. Die Kürzungen im Bundeshaushalt werden die Lage weiter verschärfen – auch in Kontexten mit strategischen Sicherheits- und Stabilisierungsinteresse Deutschlands etwa in Nahost und der Ukraine. Ohne eine radikale Kehrtwende werden im Jahr 2030 – so die Prognose der UN – 840 Millionen Menschen Hunger leiden.
Ist im BMZ-Etat für 2025 und 2026 nicht der Posten, aus dem die kirchliche Entwicklungsarbeit gefördert wird, unterdurchschnittlich gekürzt worden?
Das stimmt für die jährlichen Ausgaben, die Barmittel, die sind knapp gesunken. Aber der Topf für mittelfristige Geldzusagen, die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen, ist gegenüber 2024 drastisch gesenkt worden, und es gibt Versuche, ihn für 2026 noch weiter zu kürzen.
Wie stark werden Verpflichtungsermächtigungen für Misereor gekürzt?
Wir gehen zurzeit davon aus, dass uns hier Kürzungen in der Größenordnung von 27 Prozent ins Haus stehen. Unsere Partner verdienen Verlässlichkeit. Die Vorausschau über drei, vier Jahre ist eine eigene Qualität. Dafür werden wir kämpfen.
Müssen Sie mit Partnern darüber sprechen, manche Vorhaben nicht mehr zu fördern?
Auf einige unserer bewährten Partner kommen von mehreren Seiten gleichzeitig gravierende Einschnitte zu, weil neben den USA mehrere EU-Länder, aber auch das Vereinigte Königreich aus unserer Sicht bei der Hilfe unverantwortlich gekürzt haben. Unsere Partner sehen das und kommen nicht mit unmäßigen Forderungen, sprechen aber ihre Trauer aus. Ich habe bei einem Besuch in Sri Lanka im Februar erlebt, wie ein Menschenrechtsnetzwerk sofort ein Drittel der Belegschaft freigestellt hat, als die USAID-Mittel für 90 Tage auf Eis gelegt wurden. Als klar wurde, dass das nicht nur für 90 Tage ist, hat das die Struktur halbiert.
Versuchen Partner, im eigenen Land Geld einzuwerben?
Ja. Auch in Ländern mit sehr vielen armen Menschen gibt es sehr reiche. Wir ermutigen Partner zu mehr lokalem Fundraising und bieten dazu Schulungen und Begleitung an. Das ist an vielen Stellen, vor allem in Schwellenländern, auch durchaus erfolgreich. Aus unserer Sicht wird das aber nicht reichen.
Überlegen Sie, angesichts schrumpfender Mittel bestimmte Länder oder Regionen weniger zu fördern?
Wir haben zurzeit Projekte in 83 Ländern. Bisher haben wir noch keine dramatische Verringerung vorgenommen, aber wenn die Bedingungen so bleiben wie jetzt, werden wir das schweren Herzens tun müssen. Manche Staaten wollen auch keinen internationalen Austausch und keine Anfragen an ihr autoritäres Herrschaftssystem. Da sind Gesetze so, dass wir nicht arbeiten können. Wir sehen etwa keinen Grund, auf Spendengeld Steuern zu zahlen, um etwas bewirken zu können.
Wo müssten Sie das?
In El Salvador zum Beispiel ist so ein Gesetz auf dem Weg.
Sind in katholisch geprägten Ländern wie in Lateinamerika Kirchen und denen nahestehende Organisationen Ihre ersten Ansprechpartner?
Wir arbeiten unter anderem mit Caritas-Einrichtungen zusammen, die mehr oder weniger direkt von den Bischöfen begleitet werden, und mit NGOs, die aus christlicher Motivation entstanden sind. Aber das ist keine Bedingung. Wir arbeiten auch mit anderen Partnern, die einen glaubwürdigen humanitären Anspruch haben und bewiesen haben, dass sie nachhaltig arbeiten und zusammenhalten, statt zu spalten.
Viele Religionsgruppen im Süden sind gesellschaftspolitisch sehr konservativ. Wie gehen Sie damit um – was tun Sie zum Beispiel, wenn eine Kirche in Uganda gegen Geburtenplanung eintritt oder dafür, Homosexuelle zu diskriminieren?
Wir beauftragen niemanden mit Projekten und wir finanzieren keine Projekte, wo ersichtlich die Menschenwürde verletzt wird. Sobald wir Hinweise darauf haben, etwa auf Diskriminierung, kann das zum Abbruch des Projektes führen. Die Würde der Menschen ist unabhängig vom Geschlecht oder der Herkunft. Wir verstehen uns in der katholischen Kirche als Gerechtigkeits- und Friedensbewegung mit allen Schwestern und Brüdern in allen Ländern der Erde.
Und über Projekte hinaus – gehen Sie mit Kirchen, die solche Positionen haben, ins Gespräch?
Selbstverständlich! Wir erwarten von Projektpartnern und von deren Trägerstrukturen, auch wenn das Bistümer und Bischofskonferenzen sind, dass sie keine menschenunwürdigen oder diskriminierenden Äußerungen tun.
Das Gespräch führte Bernd Ludermann.
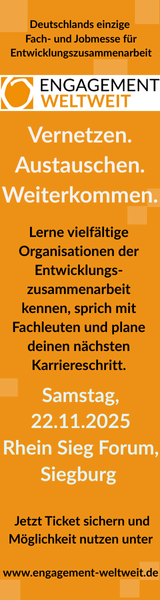
Neuen Kommentar hinzufügen