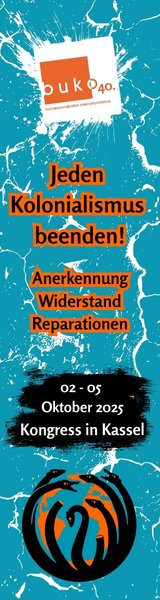Liebe Leserinnen und Leser,
vor zwanzig Jahren war ich bei einer Journalistenreise nach Südafrika zum Thema Grüne Gentechnik dabei. Eine kirchliche Hilfsorganisation hatte dazu eingeladen; sie brachte uns mit südafrikanischen Baumwollbauern zusammen, die uns erklären sollten, welche Nachteile gentechnisch verändertes Saatgut für sie habe. Aber Überraschung: Mit dem Saatgut aus dem Hause Monsanto seien sie eigentlich ganz zufrieden, damit gebe es keine Probleme, erzählten uns die Bauern. Zu kämpfen hätten sie mit anderem, etwa mit den niedrigen Baumwollpreisen.
Damals war gentechnisch verändertes Saatgut noch relativ neu, doch die Debatte, welchen Nutzen oder Schaden es Kleinbauern in Ländern des globalen Südens bringt, hat sich seitdem kaum verändert: Für die einen ist Gen-Saatgut bestenfalls nutzlos, schlimmstenfalls Teufelszeug, das die Bauern abhängig von Agrarkonzernen macht, für die anderen ist es der Schlüssel zu einer Welt ohne Hunger.
Das Monsanto-Saatgut mag den südafrikanischen Bauern vielleicht nicht geschadet haben. Viel gebracht hat es ihnen jedenfalls auch nicht. Doch die Technik hat sich weiterentwickelt, vor allem mit der Erfindung der sogenannten Gen-Schere CRISPR/Cas. Was steckt dahinter? Könnte sie der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Afrika einen Schub verleihen? Woran wird geforscht, was sagen Fachleute dazu? Diesen Fragen bin ich in meinem Beitrag nachgegangen, der in unserer jüngsten Ausgabe zum Thema Landwirtschaft erschienen ist.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Der islamistische Dreifachmord von Solingen ist fürchterlich, die politische Debatte seither zum Zusammenhang von Terrorismus und Migration ist es auch. Der Kollege Pitt von Bebenburg von der "Frankfurter Rundschau" hat trefflich kommentiert, was hier schief läuft und worauf es jetzt ankäme. Auch auf die Stimmungsmache des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geht von Bebenburg ein. Wer wie Merz nach einem Verbrechen wie dem in Solingen Deutschland als mehr oder weniger gescheiterten Staat darstellt und von "nationaler Notlage" faselt - aus politischem Kalkül oder weil er sich emotional nicht im Griff hat -, darf nicht Bundeskanzler werden. Als vor 44 Jahren mal ein nicht minder umstrittener Bayer Kanzler werden wollte, gab es eine erfolgreiche zivilgesellschaftliche Kampagne dagegen. In Erinnerung daran sollte es mit Blick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr ab sofort heißen: Stoppt Merz!
Hilfe für afghanische Unternehmen: Wie Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan unter den Taliban funktionieren kann, erklärt im Interview Bernd Leidner von der deutschen Afghan Credit Guarantee Foundation.
Die "fehlenden Frauen" nicht vergessen! In etlichen Ländern, vor allem in Asien, gelten Söhne mehr als Töchter - mit gravierenden Folgen. Ein Skandal, der zu wenig beachtet wird, auch von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, kritisiert Georg Schäfer.
Mehr Spenden, weniger Zuschüsse: Bei der Vorstellung des Misereor-Jahresberichts 2023 warnt die Organisation vor einer Vernachlässigung der Entwicklungszusammenarbeit. Barbara Erbe war bei der Pressekonferenz dabei.
Gewalt in Bangladesch: Nach dem Sturz der Regierung von Sheikh Hasina werden in dem südasiatischen Land Hindus, Buddhisten und Christen angegriffen. Sie gelten als Unterstützer der bislang herrschenden Awami-Liga. Die Übergangsregierung verspricht den Schutz religiöser Minderheiten, berichtet Katja Dorothea Buck.
Tauziehen um EU-Verordnung gegen Entwaldung: Die Kritik an der EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten wächst; Regierungen sowie Industrieverbände fordern eine Verschiebung. Umweltorganisationen und die EU-Kommission weisen das zurück. Ich habe mich mal umgehört.
Ein Viertel der humanitären Hilfe weltweit sollte direkt an lokale Organisationen fließen und von diesen verwaltet werden. So haben es die Geberländer vor acht Jahren beschlossen, doch davon sind sie weit entfernt - ebenso wie die Vereinten Nationen und große nichtstaatliche Hilfsorganisationen. Abbé Constantin Safanité Sere von der katholischen Hilfsorganisation OCADES in Burkina Faso bedauert das: Seiner Ansicht nach sollte lokales Wissen stärker genutzt werden, um die Hilfe zu verbessern, sagt er im Interview.
Mehr Natur für das Mekong-Delta: Das Delta des Mekong in Vietnam wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Folgen der menschlichen Eingriffe in den Fluss und der Klimawandel machen nun aber naturnähere Wirtschaftsweisen notwendig, berichtet Stefan Lovgren.
... und noch einmal Migration: So populistisch und hetzerisch die Gleichsetzung "Weniger Migranten (aus Afghanistan und Syrien) = weniger Messerstecher auf deutschen Straßen" ist, so populistisch und fahrlässig sind die immer gleichen Vorschläge von Friedrich Merz, Alice Weidel und Co, wie man Migration nach Europa und Deutschland reduzieren könnte: Mehr Grenzschutz, weniger Sozialleistungen. Dass das nicht funktioniert, hat mir vor einem knappen Jahr Federico Soda von der Internationalen Organisation für Migration erklärt. Er sagt: "Migration kann man nicht stoppen. Es ist eine naive Illusion, man bräuchte nur eine Mauer hochzuziehen, um damit umzugehen." Immer noch lesenswert.
Schiefes Bild von Indigenen: Indigene Gruppen in Brasilien nutzen Social-Media-Kanäle wie YouTube und TikTok, um über ihre Kultur zu informieren und auf Probleme hinzuweisen. Das aber bringt neue Schwierigkeiten, weil sie mit den Zensurvorgaben der Plattformen in Konflikt geraten, berichtet "Rest of the World".
Noch kein Fortschritt in Haiti: Seit zwei Monaten ist die von Kenia geführte internationale Polizeimission auf der Karibikinsel, doch der Gewalt der Gangs, die dort herrschen, hat sie bislang nichts entgegensetzen können. "The New Humanitarian" berichtet in einem Video über die Lage.
In Zukunft lieber Kamele: Viehhirten am Horn von Afrika, vor allem die mit Kühen, kämpfen mit zunehmender Trockenheit und Hitze als Folge des Klimawandels. Ein von der Schweiz gefördertes Entwicklungsprogramm in der Region will die Hirten dazu bringen, auf Kamele umzusteigen, die mit den harschen Bedingungen besser zurechtkommen, berichtet "Devex".
Pandemie déjà vu: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Mpox-Ausbruch in Afrika zum internationalen Notfall erklärt. Fachleute beim Center for Global Development haben sich angeschaut, wie die Welt nun damit umgeht - und fühlen sich auf ungute Weise an die Anfänge der Covid-Pandemie erinnert, insbesondere was den Zugang zu Impfstoffen betrifft.
Countdown für den UN-Zukunftsgipfel: In wenigen Wochen treffen sich die Staaten in New York zum Summit of the Future der Vereinten Nationen, schon seit Monaten wird über einen "Zukunftspakt" gefeilscht, der dort verabschiedet werden soll. Das Global Policy Forum hat nachgezeichnet, wie das Papier in den Bereichen Entwicklung und Menschenrechte im Laufe der Verhandlungen verwässert wurde.
Wie Hilfe Friedenskräfte schwächt: Humanitäre Hilfe ist in vielen krisengeschüttelten Regionen der Welt ein wichtiges Mittel, um die Not der Zivilbevölkerung zu lindern. Falsch verstanden, kann sie aber auch den Frieden vor Ort gefährden, zeigt eine Studie des britischen Think Tanks ODI zu Somalia. Barbara Erbe hat sie gelesen.
Wird BRICS mächtiger? Der Zusammenschluss wichtiger Schwellenländer wie Brasilien, China, Indien, Südafrika sowie Russland nimmt neue Mitglieder auf. Vergrößert sich damit sein weltpolitischer Einfluss? Was macht BRICS für Länder im globalen Süden attraktiv? Und welche internen Konflikte gibt es in dem Zusammenschluss? Diesen und anderen Fragen geht am 4. September eine Diskussionsrunde des GIGA-Instituts in Berlin nach, der man sich auch online zuschalten kann. Hier gibt's alle Infos.