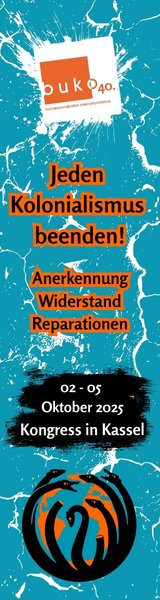Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sagt Ihnen das Kürzel KfW etwas? Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine öffentlich-rechtliche Bank, die im Auftrag des Bundes und der Länder Projekte von Privatpersonen und Institutionen fördert, für die private Geschäftsbanken vielleicht kein Geld geben oder sehr hohe Zinsen verlangen würden. Wenn Sie auf Ihrem Haus eine Solaranlage installieren wollen, sind Sie hier richtig. Die KfW wickelt auch die finanzielle Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands ab und fördert etwa erneuerbare Energien in Indien und in Afrika.
Die KfW gehört zu den Finanzinstitutionen, die unser Autor Thomas Marois für wichtige Vehikel auf dem Weg zu einer friedlicheren, gerechteren und sauberen Welt hält. In den öffentlichen Banken weltweit lagern enorme 55 Billionen US-Dollar, schreibt Marois - Geld, mit dem sich ein großer Schritt in Richtung UN-Nachhaltigkeitsziele machen ließe. Wenn es denn richtig investiert würde - und daran hapert es nach Ansicht von Marois: In der Entwicklungszusammenarbeit wird derzeit viel Kapital der öffentlichen Banken benutzt, um private Investitionen zu mobilisieren, aber das funktioniere nicht gut, schreibt Marois - und macht einen besseren Vorschlag.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.
Kurz vor der Bundestagswahl hat die CDU/CSU-Fraktion eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die jetzt hohe Wellen schlägt: Die Union will zu einem guten Dutzend nichtstaatlicher Organisationen (NGOs) wissen, ob sie staatliche Fördermittel erhalten haben und was sie mit dem Geld machen, darunter die Omas gegen Rechts, Foodwatch, das Onlinemedium Correctiv und Greenpeace. Die Fraktion argwöhnt, die Organisationen könnten das Geld für politische Arbeit verwenden, was nicht zulässig sei, da staatlich geförderte Organisationen neutral bleiben müssten. In ihrer Anfrage raunt die Union von einer "Schattenstruktur, die mit staatlichen Geldern indirekt Politik betreibt". Das klingt, als gäbe es geheime Absprachen zwischen der Regierung und den Organisationen, was natürlich Blödsinn ist, weil die Förderrichtlinien öffentlich sind und die geförderten Organisationen Rechenschaft über die Mittelverwendung ablegen müssen.
Die CDU/CSU betreibt hier dasselbe Spiel wie ihre Parteifreunde von der EVP im Europäischen Parlament, die schon seit Jahren vor allem Umweltorganisationen auf dem Kieker haben, weil ihnen deren politisches Engagement nicht passt. Den Konservativen sowohl in Brüssel als auch in Berlin wäre es wohl am liebsten, die Zivilgesellschaft erfüllte brav ein paar soziale Dienste und hielte ansonsten die Klappe - so wie in Indien, Russland oder Ungarn.
Oder auch wie in manchen ostdeutschen Bundesländern: Dort wissen Organisationen, die sich politisch für Umweltschutz, Menschenrechte und Demokratie engagieren, ein Lied zu singen von Einschüchterungsversuchen penetranter AfD-Landtagsfraktionen mittels solcher misstrauischer Anfragen. Die CDU/CSU hat sich im Bundestag jetzt diesen Stil zu eigen gemacht. Auch so kann man die Brandmauer nach ganz rechts einreißen.
Heimatlos im Lager: In Kenia leben Hunderttausende jahrelang in großen Flüchtlingslagern. Viele wollen nicht zurück in ihre Herkunftsländer und fühlen sich als Kenianer, doch die Regierung tut kaum etwas, sie im Land zu integrieren, berichtet Sirak Eshetu, der aus eigener Erfahrung schreibt.
Hessens Entwicklungspolitik: Die hessische Landesregierung hat einen Bericht über die Entwicklungszusammenarbeit des Landes vorgelegt. Er bietet Einblick in ein wenig beleuchtetes Politikfeld der Bundesländer, berichtet Claudia Mende.
Forschungspartnerschaften Österreich-Afrika: Das österreichische Bildungsministerium reguliert die Zusammenarbeit mit afrikanischen Universitäten neu. Forschende warnen vor einem entwicklungspolitischen Rückschritt, berichtet Milena Österreicher.
Von wegen gleiche Chancen: Der Global-Gender-Gap-Index misst die Geschlechtergerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Unsere aktuelle Infografik zeigt: Nur in wenigen Ländern herrscht volle Gleichheit.
„Unsere Perspektive ist einmalig und wird gebraucht“: BRAC zählt zu den größten nichtstaatlichen Hilfsorganisationen der Welt. Jetzt kommt die Organisation jetzt auch auf den entwicklungspolitischen Markt in Deutschland. Divya Bajpai von BRAC Europe erläutert die Gründe und verteidigt Mikrokredite als Mittel gegen Armut.
In der Entwicklungspolitik auf China zugehen? Fachleute rechnen nicht damit, dass die nächste Bundesregierung wie die US-Regierung die Entwicklungspolitik abschaffen wird. Aber die Rahmenbedingungen werden schwieriger, so dass über neue Wege nachgedacht werden muss, berichtet Marina Zapf.
Gestern hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erläutert, wie sie einige EU-Gesetze zum Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsschutz zu lockern gedenkt, um europäischen Unternehmen Bürokratie zu ersparen. Das sorgt für viel Kritik bei Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, aber auch auf der eher linken Seite im Europäischen Parlament, vor allem weil im Zuge der Änderungen auch das Europäische Lieferkettengesetz geschleift werden soll. Für weniger Aufregung sorgt, dass auch der sogenannte CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM entschärft werden soll, weil er angeblich der europäischen Industrie das Leben schwermacht. Das ist erstaunlich, da dieser Mechanismus doch eigentlich europäische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz schützen soll, die keinem Emissionshandel unterliegen, also nichts zahlen müssen für ihren Treibhausgasausstoß. Deshalb stieß der CBAM bisher vor allem in Schwellenländern wie Südafrika und Indien auf Kritik. Warum, hat uns bereits vor drei Jahren Nitya Nanda vom Council for Social Development in Neu-Delhi erklärt. Immer noch lesenswert.
Guter Rat aus Singapur: Nach der Demütigung aus Washington sollte Europa endlich wieder strategisch denken, sagt Kishore Mahbubani in "Foreign Policy": einen Nato-Austritt androhen, einen strategischen Handel mit Russland anstreben und sich mit China verständigen.
AKP-Organisation am Ende? Seit Jahren gibt es Ärger mit dem Brüsseler Sekretariat der Organisation Afrikanischer, Karibischer und Pazifischer Staaten. Es geht um Misswirtschaft und Verschwendung der von der EU finanziell geförderten Institution. Laut "Devex" ist die Organisation nun pleite, nachdem die EU-Kommission die Zahlungen nach neuen Vorwürfen eingestellt hat.
Syrische Frauen wollen mitreden: Nach dem Sturz von Bashar al-Assad arbeiten politische Netzwerke in Syrien und die Vereinten Nationen daran, dass Frauen in der neuen Formation des Landes eine starke Rolle spielen, berichtet PassBlue.
Österreichs Umgang mit Konfliktmineralien: Unternehmen, die Tantal, Wolfram, Zinn und Gold in die Europäische Union importieren, müssen seit dem Jahr 2021 Vorsorge tragen, dass dadurch keine Menschenrechte verletzt oder Konflikte angeheizt werden. Erfüllen österreichische Unternehmen diese Sorgfaltspflichten? Das hat die Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung untersucht.
Stärkere Miliz, weniger Gewalt? Die Angriffe der islamistischen JNIM auf Gesundheitseinrichtungen im Sahel folgen einer Strategie. Und sie sinken, weil sich die Gruppe lokal verankert, so eine neue Studie, die Bernd Ludermann gelesen hat.
Über Sehnsucht und Rebellion: Die Protagonistin des Spielfilms "Clara Sola" von Nathalie Álvarez Mesén lebt in einem Dorf in Costa Rica und leidet unter einer Wirbelsäulenverkrümmung und wird zudem von ihrer frommen und dominanten Mutter drangsaliert. Bei einem traditionellen Fest revoltiert sie gegen die Fremdbestimmung. Je länger der Film dauert, desto mehr wendet er sich dem magischen Realismus zu, schreibt unser Kritiker Reinhard Kleber, der sehr angetan von dem Streifen war. DVD oder Streaming über das EZEF.