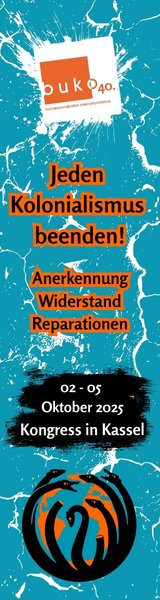Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist schwierig, in diesen Zeiten die richtigen Worte zu finden, geschweige denn Mut zu machen. Doch es gibt sie, die Länder, in denen etwas voran geht. Wo die Chance auf Besserung besteht, obwohl man schon gar nicht mehr daran geglaubt hat. Haiti ist so ein Fall. Ein Land, das in Bandenkriminalität versinkt, ein fragiler Staat, in dem nichts mehr funktioniert. Und der dazu noch fast vergessen scheint von der Weltgemeinschaft, die mit den Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und Sudan beschäftigt ist. Doch abseits der öffentlichen Wahrnehmung sind in Haiti die Polizisten der internationalen Sicherheitsmission eingetroffen, seit Ende Mai ist Garry Conille der neue Premierminister. Auch dadurch blitzt in all dem Chaos Hoffnung auf, schreiben Renata Segura und Diega Da Rin von der Crisis Group für uns. Dass der UN-Sicherheitsrat die Mission dort um ein Jahr verlängert hat, ist gut, zeigt aber auch, wie ernst die Lage in Haiti ist. Die beiden Experten der Crisis Group mahnen, dass es vor allem eine funktionierende und wirksame Regierung braucht, um die Gewalt einzudämmen und dem Wiederaufbau des Staates zu beginnen. Dennoch: "Haiti hat jetzt die Chance auf eine bessere Zukunft".
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und einen schönen Feiertag morgen.
Das Auswärtige Amt erneuert seine humanitäre Hilfe: Überschattet von drohenden Etatkürzungen hat das Auswärtige Amt eine neue Strategie für die humanitäre Hilfe im Ausland vorgelegt. Diese soll effizienter werden, Fachleute hingegen vermissen einen klaren Fokus, berichtet Marina Zapf.
Schlechte Noten für den EU-Afrika-Migrationsfonds: Seit einigen Jahren will die Europäische Union mit Hilfe von Entwicklungszusammenarbeit Migration aus Afrika verhindern. Das funktioniert nicht gut, urteilt der Europäische Rechnungshof in einem Gutachten, das Tillmann Elliesen gelesen hat.
Kein Geld mehr für das Palästinenserhilfswerk UNRWA? Der Nationalrat, die große Kammer des Schweizer Parlaments, hat sich dafür ausgesprochen, dem UN-Palästinenserhilfswerk sämtliche Finanzierung zu streichen. Linke Politiker und Vertreter von Hilfsorganisationen kritisieren das, berichtet Meret Michel.
Kein Kulturschock, aber ein Wetterschock: Liliane Tchounjin hat in Kamerun Germanistik studiert und im Rahmen eines UNESCO-Programms drei Monate bei einem Münsteraner Radiosender gearbeitet. Im Fünf-Fragen-Interview erzählt sie, warum sie trotz des schlechteren Wetters gerne weiter in Deutschland arbeiten will - und wie die deutsche Visapolitik das erschwert.
„Die Saat, die wir nun wässern und pflegen müssen“: Der auf dem UN-Zukunftsgipfel verabschiedete Pact for the Future enthält viele Schwächen, sagt Betty Wainaina von der New York University im Interview. Dennoch sei es ein Meilenstein, dass er verabschiedet wurde.
Wer verweigern will, hat es schwer: In vielen Ländern der Welt werden junge Menschen zum Militärdienst eingezogen. Was erwartet sie dort? Und wie können sie sich ihm entziehen? Wir bringen Beispiele aus Eritrea, Thailand und Kolumbien.
"Privatstädte" von Investoren sind verfassungswidrig: In Honduras haben Gemeinden der Garífunas gegen Landraub und für Landflächen gekämpft, die ihnen rechtlich gesehen gehören. Unter dem Titel "Mit Kokospalmen gegen das Großkapital" hat Knut Henkel vor knapp zwei Jahren darüber berichtet. In dem Artikel ging es auch um sogenannte Sonderwirtschaftszonen für Entwicklung und Anstellung (ZEDE), in denen die Investoren formell alle Rechte haben und einen autonomen Status genießen. Die Dorfgemeinden und Organisationen, die dagegen gekämpft haben, haben jetzt vom Obersten Gerichtshof in Honduras recht bekommen. Lesen Sie hier die noch immer interessante Geschichte.
Süß statt bitter – faire Orangen: Dass für frische Orangen in europäischen Supermärkten afrikanische Migranten in Italien ausgebeutet werden, ist mittlerweile weithin bekannt. Meist sind die Ausbeuter Kleinbauern, die selbst unter dem Preisdruck von Supermarktketten stehen. Der Verein SOS Rosarno in Kalabrien zeigt, dass es anders geht. Unser „Mitmachen“.