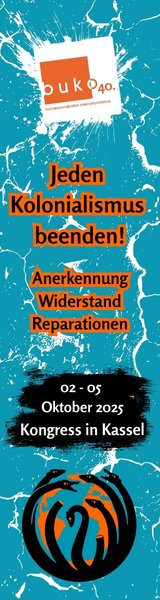heute gibt es wieder unseren exklusiven Newsletter für alle, die uns unterstützen oder abonnieren. Diesmal geht es unter anderem um den UN-Klimagipfel in Dubai, um Multilateralismus und um die Wahlen in der DR Kongo.
Die Republik Marshallinseln liegt gerade mal einen Meter über dem Meeresspiegel. Dass der durch den Klimawandel steigt, wissen wir. Die Marshallinseln und viele andere drohen deshalb in den nächsten Jahrzehnten buchstäblich unterzugehen, wenn sie sich nicht anpassen. Pünktlich zum heute gestarteten UN-Klimagipfel hat uns Tina Stege, Regierungsbeauftragte für Klimawandel der Republik Marshallinseln, aufgeschrieben, wie wichtig der Nationale Anpassungsplan ("Wir nennen ihn Überlebensplan", so Stege) für die Republik ist. Und damit kommt sie gleich auf all die großen Themen zu sprechen, über die in den nächsten zwei Wochen auch in Dubai diskutiert wird: Wie wird diese Anpassung finanziert, wer kommt für Schäden und Verluste auf - und mit welchem Geld? Das Verfahren der Klimafinanzierung sei viel zu bürokratisch und müsse geändert werden, fordert Stege in ihrem Kommentar. Zumindest was den Fonds für Schäden und Verluste angeht, dürfte sich Stege über eine gute Nachricht freuen: Denn gleich am ersten Tag haben sich die Staaten auf einen solchen Fonds geeinigt. Hoffen wir, dass es auch in den nächsten Tagen mit entschiedenen Taten weitergeht.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre,
Melanie Kräuter
"Eine Welt im Ausnahmezustand: Herausforderungen an das ökumenische Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung": So hieß eine Tagung letzte Woche im Haus am Dom in Frankfurt/Main anlässlich des 40. Jahrestages der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver. Damals, im Sommer 1983, war ich gerade mal ein Jahr alt, aber ich habe bei der Tagung ein Gefühl dafür bekommen, wie aktiv die Ökumene zu dieser Zeit gewesen sein muss und was sie bewirkt hat. Besonders beeindruckt hat mich das virtuelle Gespräch mit Allan Boesak. Als Präsident des Reformierten Weltbundes hat er 1983 auf der Vollversammlung in Vancouver gesprochen, während in seiner Heimat Südafrika das Apartheid-Regime herrschte. Durch seine Rede hat er viele Kirchen(mitglieder) hierzulande dazu bewegt, gegen die weiße Unrechtsregierung Stellung zu beziehen. Es wurden weltweit Protestmärsche und Boykotte südafrikanischer Waren organisiert. Als Anti-Apartheid-Aktivist lebte Boesak in seiner Heimat gefährlich, immer wieder ist er verhaftet worden, aber das hat ihn nie davon abgehalten, politisch und kirchlich aktiv zu sein. Das ist er auch heute mit 78 noch. Auf die Frage, wie man hier in Deutschland die Jugend wieder für die Kirche begeistern kann, sagte er, dass es seiner Meinung nach nur ein Rezept gibt: "Geht mit der Jugend auf die Straße, kämpft mit ihnen für ihre Ziele, teilt das Risiko mit ihnen. Dann seid ihr authentisch und werdet ernst genommen."
Multilateralismus von oben und von unten: Um Frieden und Gerechtigkeit weltweit voranzubringen, werden die Vereinten Nationen ebenso gebraucht wie zivilgesellschaftliche Kooperation - in Zeiten wie diesen mehr denn je, findet Tillmann Elliesen.
Bischöfe mahnen Politiker zu Besonnenheit: Gemeinsam mit ihren Kollegen aus Burundi und Ruanda fordern die katholischen Bischöfe der Demokratischen Republik Kongo ein Ende der Gewalt. Vor den Wahlen dort im Dezember droht der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt zu eskalieren, berichtet Katja Dorothea Buck.
„Wir fordern, dass der Staat die Banden entwaffnet“: In Chiapas im Süden Mexikos nehmen Gewalt und Vertreibung zu. Zwei Menschenrechtler erklären die Ursachen – von Kämpfen der Drogenbanden über Untätigkeit der Justiz und Großprojekten bis zu einem Sozialprogramm.
Anpassung an den Klimawandel ist unterfinanziert: Ausgerechnet die Staaten, die am stärksten anfällig für Klimaschäden sind, erhalten am wenigsten Geld, um sich vor Folgen des Klimawandels zu schützen. Auf diese Schieflage hat kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) das Hilfswerk Brot für die Welt hingewiesen.
Die Militärregierung in Niger hat das Anti-Migrationsgesetz zurückgenommen: Das 2015 auch auf Drängen der EU in Kraft getretene Gesetz hat jeglichen Transport von Migranten und Flüchtlingen Richtung Norden untersagt. Die Fluchtroute über Agadez nach Libyen war zuvor eine der meistgenutzten in Afrika, nun können sich Flüchtende und Migranten wieder durch den Niger in Richtung Norden aufmachen. Dass auch das Anti-Migrationsgesetz die Schleuser nicht vom Schleusen abgehalten hat, beschreibt dieser Artikel von Ty McCormick aus dem Jahr 2017: Es hat nur zu noch gefährlicheren Routen und zum Unmut der lokalen Bevölkerung geführt.
Farmer gegen Energieriese: 2017 verklagte der peruanische Bauer Saúl Luciano Lliuya mithilfe von Germanwatch den Energiekonzern RWE, er sei mitverantwortlich für die Gletscherschmelze in seiner Heimat. Seitdem läuft der Prozess. Auf "The Conversation" gibt's die ganze Geschichte.
Frisöre sind ja auch hierzulande gute Zuhörer: Aber in Togo werden sie zu Experten für seelische Gesundheit ausgebildet, berichtet die "The New York Times". Denn dort leiden immer mehr Menschen unter Depressionen, eine Therapie können sich aber nur die wenigsten leisten.
Erfolg für die Umwelt: Nach 20 Jahren hat das Oberste Gericht in Panama die Konzession für die Kupfermine des kanadischen Konzerns First Quantum Minerals für verfassungswidrig erklärt. Sie bedroht Wälder und Wasserversorgung und muss schließen, berichtet "Quartz".
Die Kreditlasten verteilt die eigene Regierung: Die Kreditbedingungen des Weltwährungsfonds (IWF) treffen die Ärmsten hart, heißt es oft. Doch ebenso wichtig ist, wie Regierungen die Programme umsetzen, finden zwei Politologen. Bernd Ludermann hat die Studie zusammengefasst.
Indien ist größter Palmöl-Konsument weltweit: Jetzt will es die Anbaufläche bis 2026 verdreifachen - auf Kosten der traditionellen Vielfalt pflanzlicher Öle aus lokaler Produktion, kritisiert "Grain".
Um die komplizierte Beziehung zwischen Deutschland und Namibia geht es am Montagabend, 11. Dezember, in Mannheim. Als Kolonialmacht hat Deutschland den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts zu verantworten. Nach jahrelangem Druck von betroffenen Gruppen in Namibia und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland begannen Verhandlungen zwischen beiden Regierungen, die zum „Versöhnungsabkommen“ von 2021 führten. Doch dieses stieß auf heftige Proteste in Deutschland und noch mehr in Namibia und wurde daher bis jetzt weder unterzeichnet noch ratifiziert. Für die Veranstaltung, organisiert unter anderem von der Werkstatt Ökonomie und der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, kommt eine hochrangige Delegation der Ovaherero nach Mannheim, geführt von ihrer höchsten Repräsentanz, dem Paramount Chief Prof. Dr. Mutjinde Katjiua. Alle Infos gibt es hier.