Herr Bliss, Sie haben im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit zwei Kolleginnen untersucht, wie die von der letzten Ministerin Svenja Schulze eingeführte feministische Entwicklungszusammenarbeit wirkt. Hat sie Gendergerechtigkeit in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gestärkt?
Absolut. Das Konzept hat im Ministerium und in allen staatlichen Entwicklungsorganisationen dazu geführt, die Strategien und die Arbeit zu Genderfragen zu überdenken. Das gilt auch für nichtstaatliche Organisationen, die im Dachverband Venro vertreten sind. Sie alle sagen, dass sie noch stärker darauf schauen, ob ihre Arbeit wirklich gendertransformativ ist – also Genderfragen nicht nur berücksichtigt, sondern wirklich darauf abzielt, die Lage von Frauen zu verbessern.
Was hat das Konzept den Frauen in Partnerländern gebracht?
Das ist schwierig zu beantworten, weil die Zeit bisher zu kurz war. Die feministische Entwicklungszusammenarbeit war ja bislang letztlich nur zwei Jahre wirksam. Aber bei der Planung von Projekten lassen sich schon Veränderungen feststellen. Ein Beispiel: Ein Standardindikator in landwirtschaftlichen Vorhaben lautet seit Jahrzehnten, dass bei Trainings für Ökolandwirtschaft 25 oder 30 Prozent der Teilnehmenden Frauen sein sollen. In einem Projekt der staatlichen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Benin wurde daraus jetzt ein wirklich qualitativer Indikator: Bei den Projektaktivitäten sollen 25 bis 30 Prozent der aufzuwertenden Landflächen im Besitz von Frauen sein.
Gendermainstreaming gibt es in der Entwicklungszusammenarbeit schon lange, also dass Frauenförderung und Gendergerechtigkeit möglichst immer mitgedacht werden. Ist die feministische Entwicklungszusammenarbeit bloß ein neues Label?
Nein, sie ist nicht bloß ein neues Label, sie geht weiter. Das Problem ist aber tatsächlich die Bezeichnung. Denn in den Partnerländern verstehen die meisten unter „feministisch“ etwas anderes, als das Konzept eigentlich will. Da wird oft gedacht, es ginge darum, Frauen aufzuwiegeln oder ähnliches. Hätte man gesagt, wir wollen Frauen gleichberechtigt mit Männern in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sehen und wir wollen gleichzeitig andere benachteiligte Gruppen wie ethnische Minderheiten gleichberechtigt sehen, dann wäre das ganz anders verstanden worden. In der praktischen Arbeit ist der Begriff „feministisch“ oft hinderlich, wenn er nicht sofort erläutert wird.
Kritiker der feministischen Entwicklungszusammenarbeit haben von Beginn an eingewandt, das sei doch weltfremd ...
Ja, aber das gilt ja auch für andere Bereiche, etwa die Bekämpfung von Korruption. Auch da kann man mit Entwicklungszusammenarbeit nicht viel machen. Entscheidend an der feministischen Entwicklungszusammenarbeit ist, dass sie die deutschen Institutionen mobilisiert hat. Die meisten sagen dann zum Beispiel gegenüber ihrem katholischen Partner in Afrika, es gehe um gleiche wirtschaftliche Rechte. Es kommt jedem Haushalt zugute, wenn in der Landwirtschaft Frauen dieselben Rechte und Möglichkeiten wie Männer haben – so begründen sie das dann.
Das Konzept hat die entwicklungspolitischen Institutionen mobilisiert, aber laut Ihrer Untersuchung hapert es hier und da trotzdem an der Umsetzung. Warum?
Es bräuchte – und das ist nicht neu – in der Projektarbeit Ansätze, die soziokulturelle Umstände in den Projektgebieten berücksichtigen. Dafür werden ausreichend geschultes Personal und finanzielle Ressourcen benötigt. Wenn ich transformativ arbeiten, also die Bedingungen für Frauen wirklich verändern will, muss ich noch intensiver planen und brauche vor Ort noch mehr Personal, das etwa als Vermittler arbeitet. Und es braucht Leute, die die kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gut kennen. Dazu müssten die Organisationen zusätzliche Mittel bereitstellen oder ihre Budgets umschichten. Das ist oft nicht passiert.
Das Bewusstsein in den Institutionen ist also gewachsen, aber das schlägt sich in ihren Budgets und in der Personalplanung bislang nicht nieder?
Genau.
Und angesichts der anstehenden Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit in den kommenden Jahren wird sich das auch nicht bessern, oder?
Im Gegenteil: In den staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die jetzt sparen müssen, wird immer stärker auf die Abwicklung von Projekten geachtet und immer weniger auf das erforderliche Denken. Entsprechend haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Genderfragen zuständig sind, derzeit große Sorge, dass sie eingespart werden. Darüber wird bei Venro-Mitgliedern gerade viel diskutiert. Das betrifft auch die Vorbereitung von Auslandsmitarbeitern: Die entsprechenden Länderkurse haben früher drei Monate gedauert, heute sind das nur noch ein paar Tage – mit viel Selbstlernen. Aber wenn ich für Genderfragen in Ländern mit konservativen patriarchalischen Strukturen zuständig bin, kann ich mir das erforderliche Wissen über die Rahmenbedingungen nicht mal eben im Selbststudium draufschaffen.
Für mich klingt das unterm Strich dann doch so, dass die feministische Entwicklungszusammenarbeit mehr schöner Schein als Sein ist.
Ich würde es so beschreiben: Da ist ein luxuriöser Zug mit hoch motivierten Passagieren aufs Gleis gesetzt worden, aber es wird während der Fahrt ständig an Kohle gespart, so dass der Zug das Tempo drosseln muss und niemand weiß, ob man überhaupt den nächsten Bahnhof erreicht. Mit Blick auf das erforderliche Personal heißt das etwa: Alle Organisationen haben als Folge der feministischen Entwicklungszusammenarbeit heute deutlich mehr Ansprechpartner für Genderfragen, aber die wenigsten machen das auf eigenen Stellen. Das wird immer noch als Aufgabe gesehen, die man nebenbei oder zusätzlich zur eigentlichen Tätigkeit machen kann. Das zeigt, dass die Entscheidungsträger in vielen Institutionen dann doch nicht so dahinterstehen.
Was lässt sich aus Ihrer Analyse für eine auf Gendergerechtigkeit zielende Entwicklungszusammenarbeit lernen?
Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Gendergerechtigkeit nicht bloß ein Nebenaspekt in der Projektarbeit sein darf, sondern im Mittelpunkt stehen muss. Da hatte Svenja Schulze als Ministerin völlig recht. Man kann ein Projekt zur Stärkung von Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft voll auf Gender ausrichten – was vor allem dort sinnvoll ist, wo schon heute die Mehrzahl der Beteiligten Frauen sind. Entscheidend ist, Strukturen zu verändern. Das heißt, man muss zum Beispiel Kooperativen und Verbände schaffen, die Saatgut und Düngemittel für Frauen zugänglich machen oder bei der Vermarktung helfen. Und man muss echte zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort stärken, also etwa juristische Organisationen, die sich um Landrechte von Frauen kümmern. Das darf nicht nur nebenbei geschehen, weil sie vielleicht für ein bestimmtes Projekt wichtig sind. Zivilgesellschaft muss als solche unterstützt werden und nicht bloß als Hilfsagentur für Projekte.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
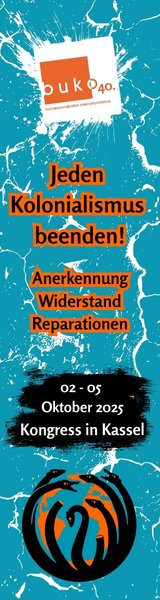
Neuen Kommentar hinzufügen