Sie haben kürzlich als Kuratorin das African Book Festival in Berlin geleitet. Lichtinstallationen von lila Spinnennetzen umrahmten die Lesungen. Was hat es damit auf sich?
Etliche unserer Ursprungsgeschichten sind mit der Spinne verbunden. So ist der Kente-Stoff aus handgewebten Baumwollstreifen, die oft mit leuchtenden Farben und komplexen Mustern gestaltet werden, das wichtigste Symbol der Akan sprechenden Bevölkerung im Süden Ghanas. Es gibt eine Geschichte, in der eine kenntnisreiche männliche Spinne (Ananse oder Anansi genannt) im Wald den Männern die Kente-Weberei beibringt. Ananse gilt deshalb als weise und auch als Ursprung der Kreativität. Er ist ein Künstler, dafür mag ich ihn. Und er stellt Verbindungen zum Geschichtenerzählen her, in der Akan-Sprache sind alle erfundenen Geschichten eng mit ihm verbunden.
Sie tragen Schmuck in Form einer Spinne und nennen sich Spider Girl. Wie wurde die Ananse-Spinne zu Ihrer Leitfigur?
Ananse ist kein Held, eher das Gegenteil: eine männliche Tricksterfigur. Manche meinen, sie verdirbt Kinder und stachelt sie zur Rebellion an. Dennoch lieben viele Menschen sie, wir werden sie einfach nicht los. Ich habe mir überlegt, was ich in meinen Erzählungen an Neuem bringen könnte. Aus diesem Grund verwandelte ich Ananse in einen Teenager, und zwar in ein Mädchen namens Kuukua Annan. Sie ist keine sympathische Protagonistin, sondern eine widersprüchliche Gestalt und deshalb ebenso verschrien wie die männliche Tricksterfigur. Deshalb war meine Leserschaft wenig begeistert. Jeder ist an das Verhalten von Männern gewöhnt, deshalb wurde Ananse nie kritisiert. Für das gleiche dominierende Verhalten vonseiten einer jungen Frau aber gab es aufgrund unbewusster Annahmen sofort Kritik – sie sollte liebenswürdig sein. Ich hatte dagegen Freude daran, sie unsympathisch zu lassen. Beim Schreiben betrachte ich die Welt als Frau, auch männliche Charaktere sehe ich aus einer weiblichen Perspektive. Zur Frage, ob das feministisch ist, bin ich nicht festgelegt. Es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung, Schriftstellerin zu sein.
Sie reflektieren also differenziert über Frauenrollen. Wie kamen Sie zum Schreiben?
Ich wuchs mit Klassikern der weißen europäischen Literatur auf wie Enid Blyton und Roald Dahl. Während ich sie in meiner Jugend las, dachte ich darüber nach, wie es wohl wäre, wenn solche Geschichten in meiner Nachbarschaft in Accra spielen würden. So übersetzte ich sie in meinen Kontext, also in unser Alltagsleben. Ich begann, heimlich auf dem Laptop meines Vaters eigene Geschichten zu schreiben. Dann zeigte ich sie meinem Großvater, er war mein erster Leser. Seine Vorfahren sprachen Ewe, während meine Mutter Ashanti, eine Akan-Sprache, von Kindheit an erlernte. Ihre Ahninnen kamen aber aus Mali. So wuchs ich mit verschiedenen Sprachen und Geschichten auf.
Ihre aktuelle Novelle „Das Jahr der Rückkehr“ dreht sich um das Jahr 1619, als der Handel mit Sklaven aus Westafrika begann, und um das Gedenkjahr 2019 zu 400 Jahren Sklaverei in Ghana. Worum geht es?
Ich denke, wir haben uns noch nicht genug mit dem Sklavenhandel befasst. Ein Beleg dafür ist die Tatsache, dass die ghanaische Regierung die Sklavenburgen, also die Festungen, von denen afrikanische Sklaven nach Amerika verschifft wurden, zum Touristenziel Nr. 1 erklärt hat. Erzählungen widmen sich dem Problem, wie Sklaverei sich weltweit ausgewirkt hat, aber fast nur mit Blick auf die Menschen an den Zielorten. Es gibt kaum Belletristik zu den Folgen auf dem afrikanischen Kontinent, etwa die Geschichte der Kollaboration mit den Sklavenhändlern, die teilweise selbst in Nord- und Südghana Sklaven besaßen. Als ich 2021 dazu recherchierte und Fragen nach einer bestimmten Familie stellte, fragte man mich, wer mich geschickt hätte und was genau ich suchte. Das alles nur wegen der historischen Verbindungen einer Familie mit der Sklaverei. Es wird noch immer viel gestritten und im Verborgenen gehalten.
In meiner Novelle reist Adwapa, die in Ghana aufgewachsen ist und in den USA studiert hat, für ihren Job als Journalistin in ihre Heimat. Dort lebt ihre Mutter, eine Ärztin. Aus deren Sicht ist Sklaverei vorrangig ein Problem der Menschen in der Diaspora. Sie fragt, warum Afroamerikaner sich nicht von ihrer Perspektive auf die Sklaverei wegbewegen. In Ghana aber leben wir im Umkreis der Sklavengebäude, wir schieben sie einfach gedanklich zur Seite. Es sind heute Touristenorte, nichts weiter. Es braucht ein übernatürliches Phänomen, um ein gewisses Maß an Empathie zu erzeugen. Dabei geht es um Geister von Versklavten, die auf der Überfahrt gestorben sind und nicht beerdigt wurden.
Sie thematisieren gesellschaftliche Probleme wie etwa Hexerei. Hatten Sie deshalb schon Ärger?
2019 begann ich, über mysteriöse Themen zu schreiben. Meine Leser und Fans wussten also schon, dass sie Magie und skurrile Geschöpfe erwarten konnten. Da ich Christin und im christlichen Umfeld engagiert bin, gab es keine Vorbehalte mir gegenüber und keiner fragte: Was macht die böse Person da? Ich ging in die Kirche, deshalb ließ man mich schreiben, was ich wollte. Und man muss lokale, überlieferte Vorstellungen beachten, um die Ironie zu erkennen, wie die Welt zu dem wurde, was sie ist. Wenn du also in Afrika heute denkst, dass Hexerei deine Probleme löst, gehst du standardmäßig zu einem Mann, der ein dafür notwendiges Ritual durchführt. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, wird aber eine Hexe als Verursacherin dafür verantwortlich gemacht. Es ist die gleiche Hexerei, aber Frauen machen die Fehler und Männer alles richtig. Das sagt viel über gesellschaftliche Hierarchien.
Sie schreiben über unterschiedliche Themen und nutzen verschiedene literarische Gattungen: Novellen, Kurzgeschichten, Lyrik. Wählen Sie aus, was zueinander passt?
Ich liebe Sprache und das Geschichtenerzählen. Wenn ich eine Idee habe, fällt mir auch die dazu passende Form ein. Diese wähle ich nicht speziell aus. Anders ist es mit der Sprache, etwa in Accra. Dort kann ich nicht einfach Standardenglisch nutzen, denn die Leute sprechen einzigartiges ghanaisches Englisch. Das ist so kosmopolitisch wie die Stadt – eine Mischung aus Pidgin English, Ga, Ewe, Hausa und weiteren Sprachen. Es ist gepfeffert mit unserem Alltagsleben, sogar die Namen für unser Essen werden selten übersetzt.
Manche Dinge lassen sich am besten in unterschiedlichen Lokalsprachen ausdrücken. Ich spreche selbst aber nur eine Lokalsprache, deshalb frage ich meine Freunde nach der korrekten Grammatik und den besten Übersetzungen. Das betrifft vor allem Worte, die nicht alltäglich sind. So möchte ich ghanaische Erfahrungen repräsentieren und eine ghanaische Leserschaft erreichen.
Das Gespräch führte Rita Schäfer.
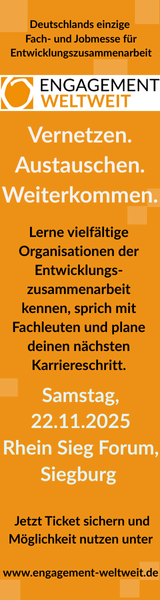
Neuen Kommentar hinzufügen