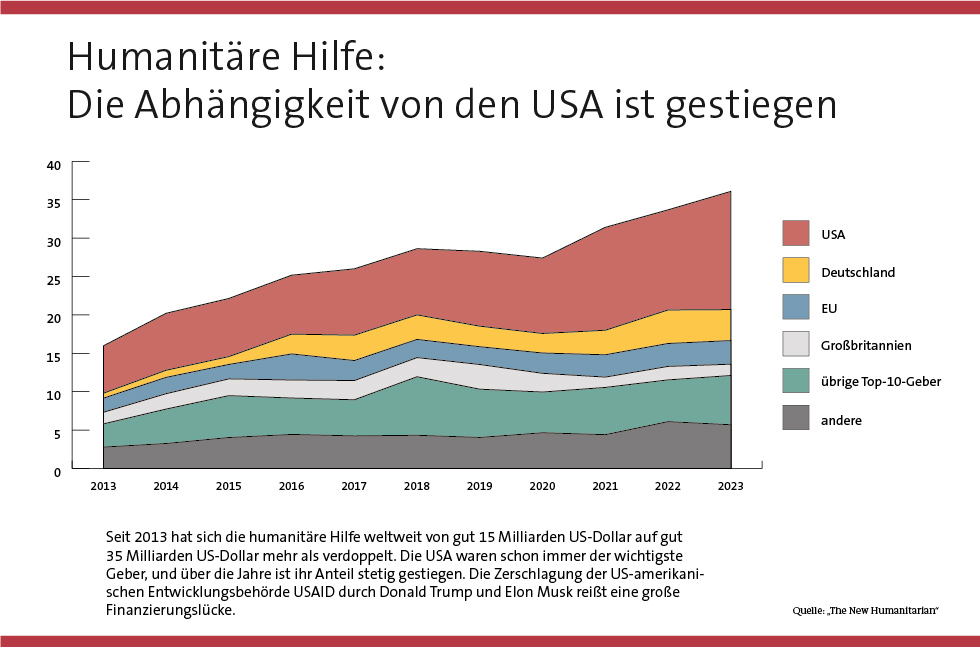Eine gerechtere und friedlichere Welt ist möglich – und die Entwicklungspolitik soll dazu beitragen. Noch dominieren westliche Geberländer das Feld, doch große Schwellenländer wie Brasilien, China und Indien engagieren sich zunehmend in der Süd-Süd-Kooperation. Die Ziele von Entwicklungspolitik ändern sich, seit es sie gibt. Und immer ist sie dem Risiko ausgesetzt, für andere politische Zwecke instrumentalisiert zu werden.
Die Erderhitzung hat gravierende Folgen für Mensch und Natur – nicht zuletzt im globalen Süden. Doch die Wohlhabenden im Norden und neuerdings in Schwellenländern wie China verursachen die meisten Treibhausgase, die den Klimawandel antreiben. Deswegen verlangen Stimmen im Süden neben globalem Klimaschutz auch Klimagerechtigkeit und internationale Finanzierung für die unvermeidliche Klima-Anpassung.