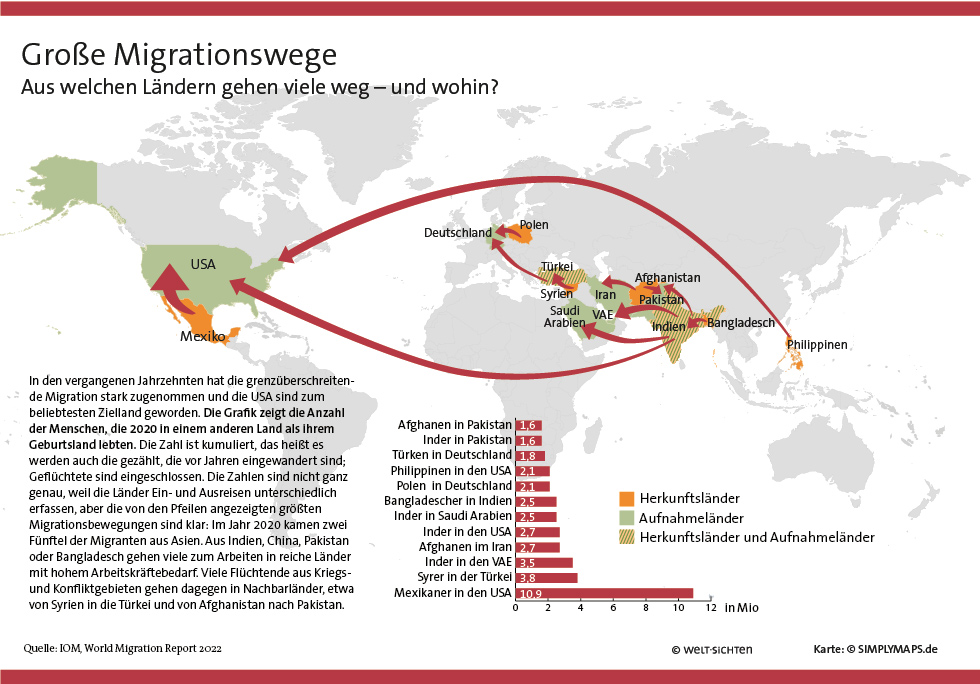Auch eine neuere Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft kommt zu dem Ergebnis, dass irreguläre Migration durch Entwicklungspolitik nicht gemindert wird.
Wie immer sich Entwicklungsprojekte lokal auswirken, das große Bild ist klar: Wenn ein armes Land sich entwickelt, nimmt mit den Einkommen, dem Bildungsstand und der Verkehrsinfrastruktur auch die Mobilität zunächst zu – sowohl im Land, besonders in die Städte, als auch Richtung Ausland. Mehr Menschen finden in anderen Ländern Arbeit, teils für begrenzte Zeit, und senden oft einen Teil des Verdienstes zurück an ihre Familien. Diese Rücküberweisungen von Migranten in ihre Heimatländer sind nicht zu unterschätzen: 2020 waren es weltweit mehr als 700 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu insgesamt 161 Milliarden an öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA). Wenn ein Land einen gewissen Wohlstand erreicht hat, sinkt die Abwanderung wieder – und nach und nach werden Länder mit mittlerem Einkommen wie Marokko oder Thailand selbst das Ziel von Zuwanderung. Das oberste Ziel von Entwicklungszusammenarbeit sollte also sein, Menschen in ihrer Heimat ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – nicht, Migration einzudämmen.
Entwicklungszusammenarbeit kann aber dazu beitragen, Vertreibung und Fluchtbewegungen vorzubeugen. Denn der wichtigste Grund von Flucht und Vertreibung sind Kriege. Entscheidend für die Bekämpfung von Fluchtursachen ist also, Frieden zu fördern und zu stabilisieren. Zugleich müssen Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländer beim Umgang mit Geflüchteten unterstützt werden.
Darum geht es auch im von den Vereinten Nationen ausgearbeiteten „Globalen Flüchtlingspakt“, den im Dezember 2018 eine große Mehrheit der Staaten angenommen hat. Sein Ziel ist unter anderem, die Aufgaben beim Flüchtlingsschutz gerechter zu verteilen, die internationale Zusammenarbeit zu verbessern und Flüchtlingen bessere Perspektiven zu öffnen. Ebenfalls 2018 haben die UN den „Globalen Pakt zur sicheren, geordneten und regulären Migration“ verabschiedet mit dem Ziel, den Nutzen der (freiwilligen) Migration für Herkunfts- und Zielländer zu optimieren und gleichzeitig die Risiken für Migranten und aufnehmende Gemeinschaften zu verringern. Beide Pakte sind nicht bindend.